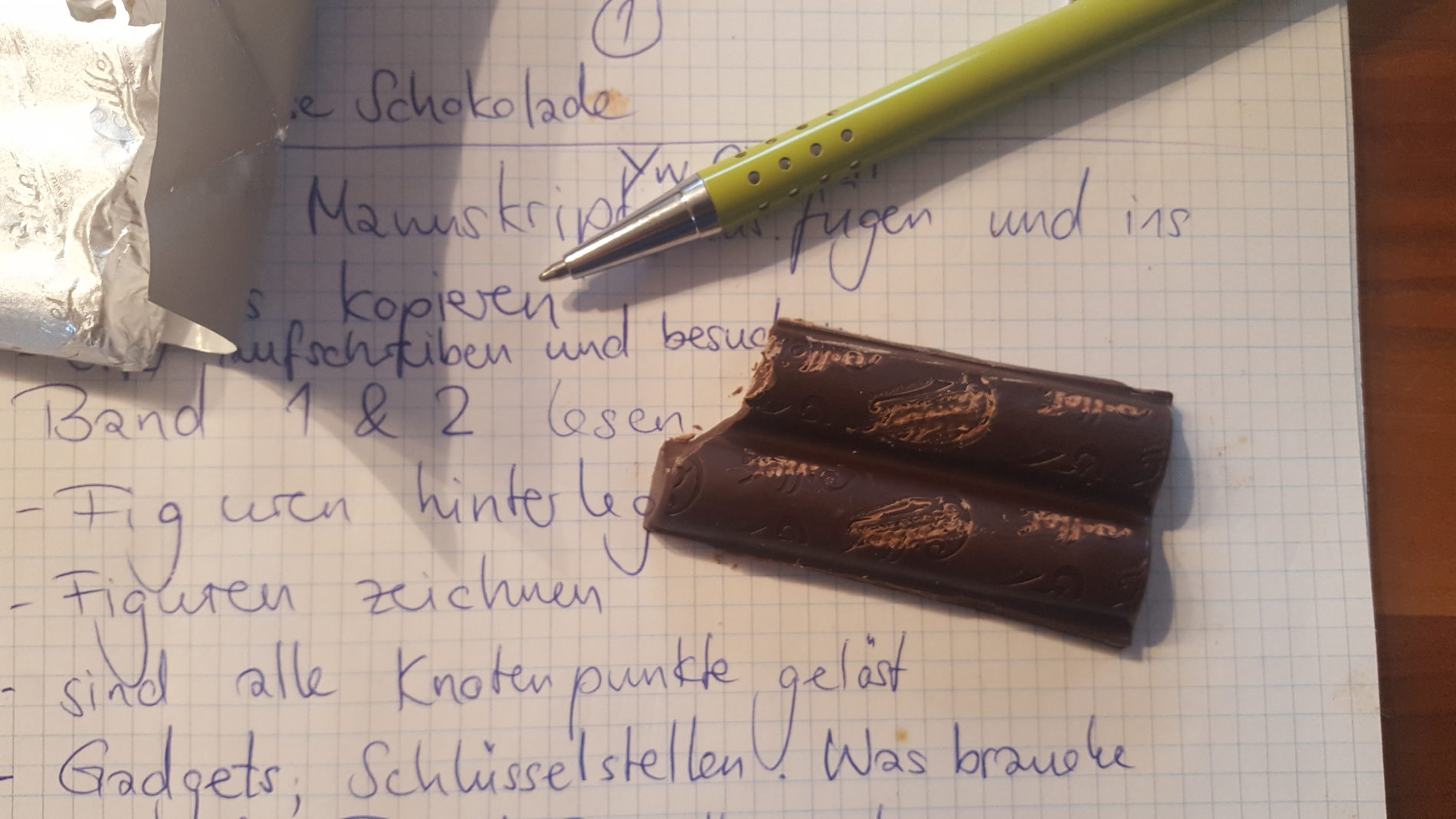Vor meinen inneren Augen sehe ich sie immer noch vor mir: Die Magnetplatte mit den Buchstaben, mit denen ich schon als kleines Kind spielte. Das P ist grün, das D auch. Aber O und U sind gelb, und mein Lieblingsbuchstabe Y ein grelles Rot. Diese Farben haben die Lettern bis heute in meinen Kopf.
Aber Buchstaben sind nicht nur farbige Zeichen. Buchstaben sind Klänge, sind Sprache. Das Tor zu einer Zauberwelt, einem Schlaraffenland.
Buchstaben sind Lautmalerei. So ist Haha eine kunterbunte Explosion von Freude, hihi deren kleine schüchterne Schwester und höhö der grosse schadenfreudige Bruder. Iiiih ist Ekel pur. – Siehst du den grünen Rotz?
Pfu-iii ist die kalte Hundeschnauze und Ng-ng-ng kochtopfrote Wut.
Buchstaben tanzen wie Schmetterlinge über dem Lavendel – Garten meiner Seele. Tag und Nacht feiern sie vor meinen Augen ein Fest. Sie sind meine imaginären Freunde, die mir zu Zeiten und Unzeiten zurufen: „Komm und spiel mit uns!“ Sie locken mich, verführen mich dazu, sie zu umfassen und zu tausenden neuen Kombinationen zusammenzufügen.
Buchstaben setzen Grenzen. Das sanfte Knallen des P’s sagt: „Stopp! Komm nicht näher!“ „Hallo“ hingegen ist eine sanfte und einladende Umarmung.
Andere joggen oder stricken zur Entspannung. Ich lese oder schreibe.
Buchstaben beruhigen mich. Immer. Wenn das Chaos im Hirn ein schwarzes Knäuel zusammengeknautschter, nasser, zerraufter Schafwolle ist, dröseln Buchstaben und Wörter das Durcheinander zu einzelnen zu bewältigenden Fäden auf. Ist der Alltag unerträglich, streicheln die Wörter mein Hirn rufen ihm zu: „Das Leben ist doch schön.“
Musik kann laut und störend sein, menschliche Stimmen schrill und kratzig. Aber Buchstaben sind immer angemessen.
Buchstaben rufen Bilder und Stimmungen hervor, wie Abendrot und Sturmwolke.
Tulpe, Banane, Blatt und Regentropfen sind klaren Farben und Formen zugeordnet.
Es gibt kurze Wörter, die aber im Kern kompliziert sind wie ich und du. Es gibt kleine Wörter die grosse Auswirkungen haben so wie Ja und Nein.
Viele beschweren sich über die Gross- und Kleinschreibung im Deutschen. Dabei empfinde ich die Grossbuchstaben als besonders ästhetisch. Sie beschreiben konkrete Dinge wie Ähre oder abstrakte Begriffe wie Geborgenheit. Man braucht sie für die Namen von geliebten Menschen oder von exotischen Orten, die man noch bereisen möchte.
Mit Buchstaben kann man sogar rechnen. Aber wer will das schon, wenn man immer noch neue Wörter damit formen kann, die man bisher nicht gekannt hat, wie „Petrichor“ und „Koryphäe“?
Andere Menschen denken in Bildern oder Zahlen. Ich denke in Buchstaben.
Wenn ich mir langweilige Dinge anhören muss, wie zum Beispiel eine Predigt mit einem Haufen mansplaining drin oder einen Vortrag über steuerliche Vorteile der Innerschweizer Kantone, zeichne ich das Alphabet auf und schon eröffnen sich mir fantasievolle Welten, in die niemand sonst Zutritt hat.
Als ich mal jemandem gestand, dass ich zu Hause heimlich den Duden lese und nebenher noch den „Oxford Dictionary of English“, starrte die Person mich entgeistert an, als hätte ich einen an der Waffel. Und ich verteidigte mich stotternd: „Aber … Wörter … weisst du?“ Ich rümpfe ja schliesslich auch nicht die Nase über Menschen, die den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen oder – heaven forbid! – ein Modemagazin.
Und wenn ich dann denke, die deutsche Sprache ist doch endlich, da geht nichts mehr, lassen sich die Buchstaben noch in tausenden anderen Sprachen zu Kombinationen zusammenfügen, die das Herz so noch nicht kannte und immer wieder von Neuem erfreuen.
Was für schöne Worte sind zum Beispiel pyykkipoika (Wäscheklammer auf Finnisch), oder imperméable (Regenschutz auf Französisch; wörtlich wasserundurchlässig) oder amore (Liebe auf Italienisch). Ui ist die Zwiebel auf Niederländisch, maji heisst Wasser auf Suaheli oder dann doughnut (wörtlich: Teignuss) das köstliche, zuckersüsse Gebäck aus Amerika.
Da möchte ich gleich einen Spaten schultern und auf den Acker der Weltsprachen ziehen, um dort ein bisschen zu buddeln. Ich kann mir kaum ausmalen, was für unentdeckte Schätze in den Sprachen schlummern, die sich mit lateinischen Zeichen nicht ausdrücken lassen.
Photo by Anders Nord on Unsplash