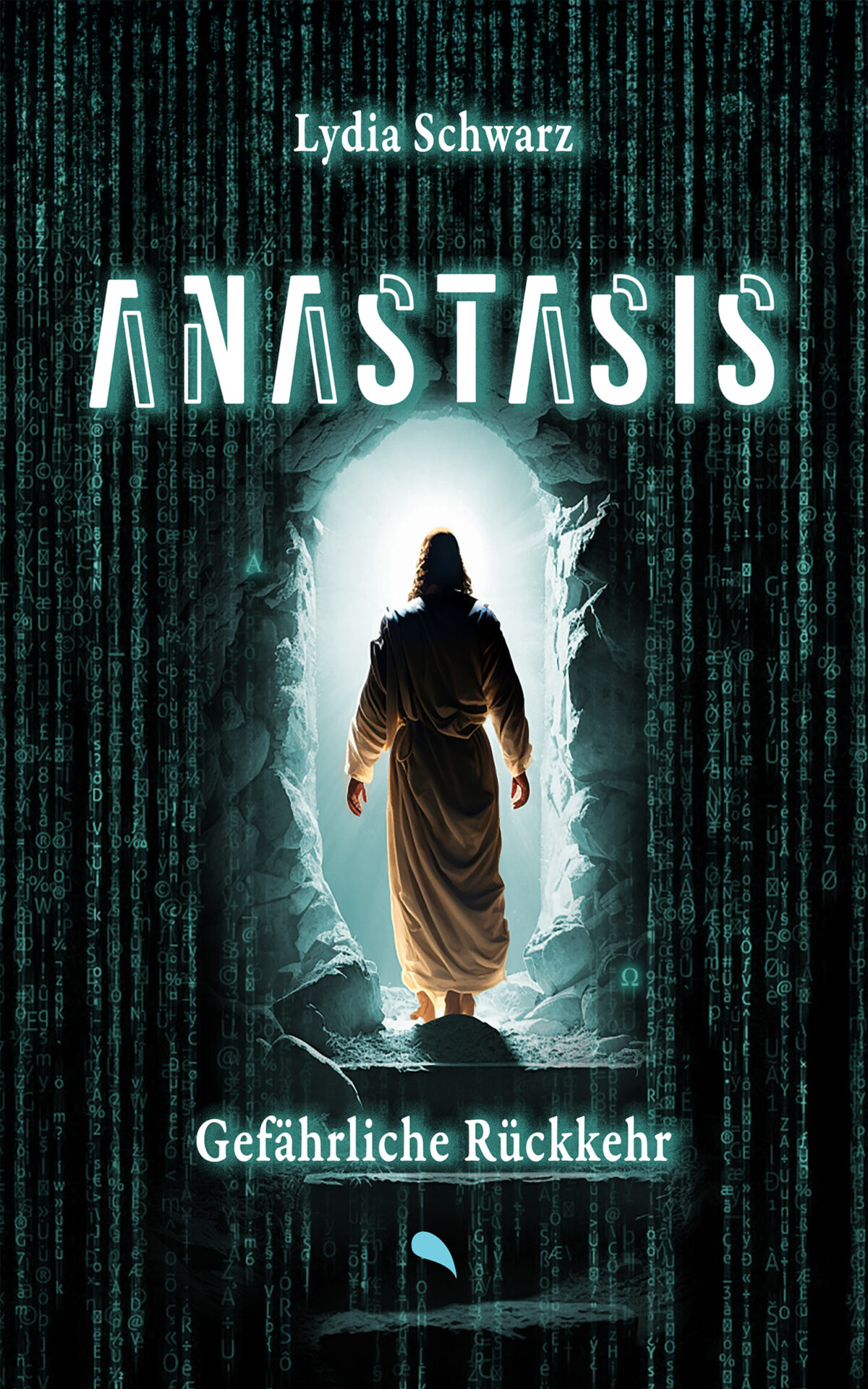Na? Heute schon unzufrieden gewesen? Ich schon! Und zwar mit meinen Kindern. Weil diese wiederum unzufrieden waren mit dem Essen, das ich ihnen aufgetischt habe.
Jaja, ich weiss ja, dass man die Kinder nicht zum Essen zwingen soll und dass ihre Geschmacksknospen sich erst mit der Zeit vollends entwickeln und blablabla …
Aber heute ist mir echt der Kragen geplatzt. Ich bin nicht Köchin aus Leidenschaft. Ich stelle das Essen auf den Tisch, weil jemand es tun muss und weil die Kinder sich halbwegs gesund ernähren sollten et cetera.
Und ja, ich zermartere mir pausenlos das Gehirn, von dem Moment an, wenn ich das Essen aus dem Einkaufsregal nehme und in den übervollen Einkaufswagen stopfe, bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich vor dem geöffneten überbordenden Kühlschrank stehe und mir den Haarboden wundkratze, weil ich etwas Fantasievolles zaubern möchte, mir aber beim besten Willen nix einfällt, das ich in den letzten zwei Wochen nicht schon zigmal gekocht habe.
Heute ist Sonntag. Der Sonntag, an dem andere die Füsse hochlegen, aber Mutter trotzdem das Essen auf den Tisch stellen muss. Ich habe nicht mal eine schlechte Idee: Gefüllte Paprika mit Hackfleisch, das an anderen Tagen auch schon von allen klaglos gegessen wurde. Ich habe während des Kochprozesses Freude an meinem neuen Backofen, der jetzt endlich hält, was er verspricht. Ich stelle das Backblech auf den Tisch – und dann geht’s los:
„Was ist das? … So wenig Auswahl? … Ich habe die Zwiebeln nicht gern … Es ist zu heiss … Ich habe das Hackfleisch nicht gern … “ Und dann schlürfen sie schon mal gemächlich ihr Sirüpchen, als würde plötzlich wie durch ein Wunder etwas anderes auf ihren Tellern erscheinen, wenn sie nur noch genug lange warten.
Der Gipfel ist erreicht, als meine Dreijährige eine Paprika vom Teller nimmt, sie schüttelt und das Hackfleisch uns allen um die Ohren fliegt.
Wut dreht eine brennende Spirale meine Speiseröhre hoch und äussert sich dummerweise in Tränen. Die Stimmung kippt schlagartig auf Alarmstufe Rot. Wie immer, wenn Mami weint. (Ach, die liebe Dünnhäutigkeit … Was gäbe ich in einem solchen Moment um ein Pokerface!)
„Warum weinst du?“, piepst eine der zwei Delinquentinnen ganz vorsichtig.
„Weil ich wütend bin“, antworte ich ehrlich.
„Auf wen?“
„Auf euch!“
Und das lasse ich einfach mal eiskalt so im Raum stehen.
Papi erläutert dann der betroffenen Nachkommenschaft meine schroffen Worte, erklärt geduldig und leistet Schadensbegrenzung.
Wie dankbar bin ich um seinen kühlen Kopf. Denn in der Wuthitze brauche ich meine restliche Selbstbeherrschung, um nicht den vollen Porzellanteller an die weisse Wand zu deppern. Ich habe keine Luft für vernünftige Erklärungen.
Nach kurzer Zeit merke ich, dass ich eigentlich nicht wirklich auf die Kinder wütend bin. Denn sie spiegeln ja nur das wieder, was ihnen vorgelebt wird. Von uns. Als Eltern. Als Gesellschaft.
Ich bin auch nicht so sehr verletzt, weil die Arbeit meiner Hände einmal mehr nicht gewürdigt wird. (Undankbarkeit ist nicht schön, aber irgendwie Teil des Jobs.)
Aber ich bin wütend auf das grosse Ganze. Auf uns Schweizerinnen und Schweizer, weil wir so unverschämt reich sind. Wir sitzen in einem Füllhorn von Nettigkeiten und drehen trotzdem durch wegen der Aussicht, dass ein Lieferengpass für eine von 45 möglichen Müesli-Sorten bestehen könnte.
Ich bin wütend, weil ausserhalb unserer Seifenblase, Menschen buchstäblich an Armut und Hunger verrecken und wir so erfolgreich darin sind, diese Tatsachen zu verdrängen.
Wir sorgen uns um unser eigenes kleines Leben und unser kleines Gärtchen mit dem Zaun drum herum. Dabei muss in der Notsituation unser Ueli nur wieder mal sein Staatskässeli schütteln, dann fallen wieder ein paar Milliärdchen mehr raus – und gut is‘.
Und während ich nach Worten ringe, wie ich den Kindern erklären soll, was in mir vorgeht, nehme ich sie auf den Schoss und erzähle ihnen die Geschichte vom kenianischen Mädchen, nennen wir sie Ndanu.
Ndanu war etwa vier Jahre alt, als ich sie kennenlernte. Sie kam jeden Morgen einen weiten Weg zu dem Kindergarten, in dem ich damals aushalf.
Die Kindergärtnerin überliess morgens Ndanu und ihre Kameraden etwa eine Viertelstunde meiner alleinigen Obhut, um in ihrer Küche einen unansehnlichen Brei zu kochen, den sie den Kindern zum Znüni in farbigen Bechern servierte. Ich probierte einmal eine Messerspitze voll. Es war eine lauwarme geschmacklose Pampe von hellbrauner Kotz-Konsistenz.
Niemals vergesse ich Ndanus Gesicht, die einen Schluck von der Sosse nahm, und mich dann mit einem Mäusezähnchen-Lächeln anstrahlte. Es schmeckte ihr, das war offensichtlich.
„Es ist für viele die einzige warme Mahlzeit am Tag“, informierte mich die Kindergärtnerin.
Der Kontrast dieser strahlenden Augen wegen einer erbärmlichen Mahlzeit, zu dem unzufriedenen Gemecker meiner Kinder in Anbetracht einer üppigen Mahlzeit könnte nicht grösser sein – und ist wie ein Schlag in die Magengrube.
Wie kann ich meinen Kindern beibringen, dass wir eigentlich in einer Fake-Welt leben? Dass wir zu einer minimalen Oberschicht gehören, die in Saus und Braus lebt und doch niemals genug hat? Das unsere Kaninchen besser essen, als viele Kinder in anderen Teilen dieser Welt. Wie kann ich sie sensibilisieren, ohne ihnen unnötige Schuldgefühle einzuimpfen? Denn niemand von uns kann etwas dafür, dass wir so privilegiert geboren sind.
Hilflos überlege ich, was ich denn überhaupt in meiner bevorzugten Stellung machen kann, um Armut und Hunger zu lindern.
Soll ich Geld spenden? Nützt es, wenn ich (nach der Corona-Pandemie) Leute in armen Ländern besuche?
Gibt es überhaupt noch Hilfsorganisationen, die nicht korrumpiert sind? Gibt es noch Menschen und Firmen, die uneigennützig ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit und ihren Wohlstand anderen Menschen helfen?
Wenn ich mich selbst anschaue, wenn ich einen Blick in die Welt mache, zweifle ich stark daran und finde heute keine Antwort darauf. Was bleibt ist die Wut – und die Unzufriedenheit.
Photo by James Fitzgerald on Unsplash